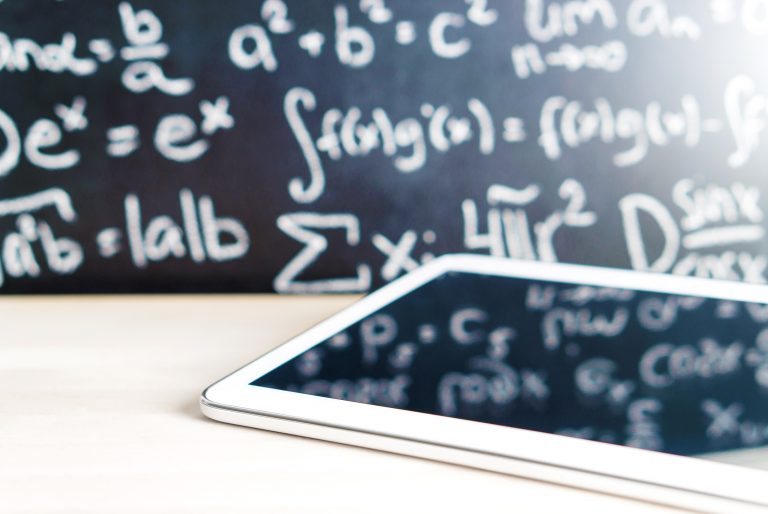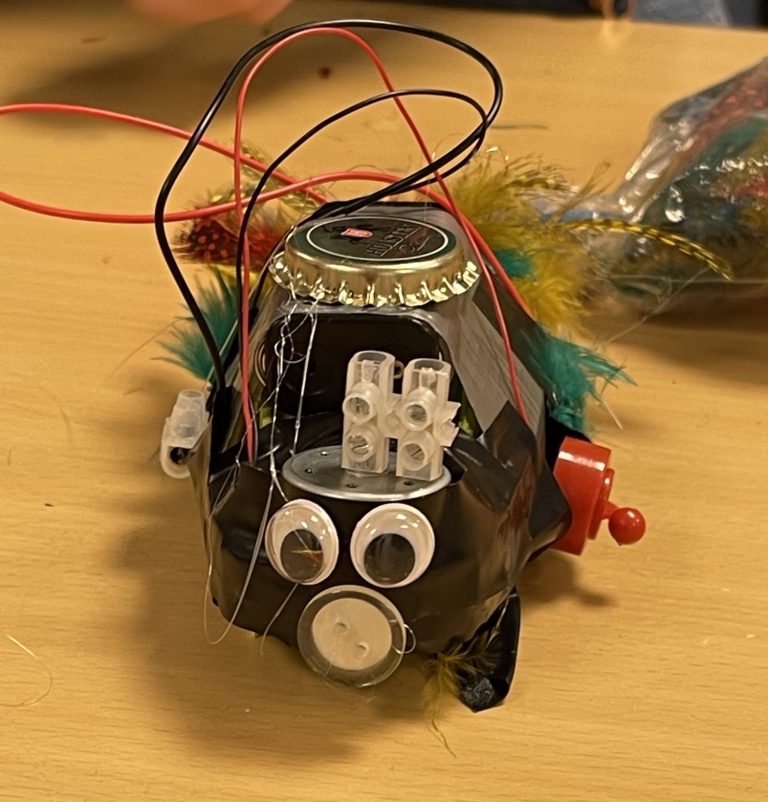Bild: VD17
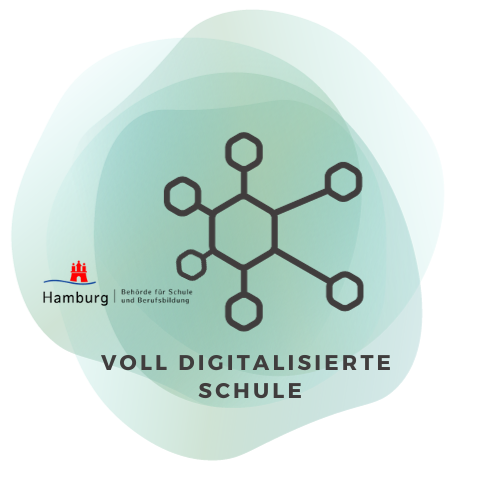
Das Projekt „Voll digitalisierte Schule“
Wie muss Unterricht gestaltet werden, wenn jedes Kind über ein eigenes Endgerät verfügt? Welche Chancen und Herausforderungen bietet dieses Vorhaben für die Schülerschaft, aber auch für das Kollegium? Wie muss sich die eigene Schule als Organisation verändern, um nicht nur über die Vermittlung der „21st century skills“ zu reden, sondern diese auch zu leben? Diese und weitere Fragen stehen im Zentrum des Projekts „Voll digitalisierte Schule“. Auf Initiative eines Bürgerschaftlichen Ersuchens wurden sechs Grund- und sechs weiterführende Schulen mit unterschiedlichen KESS-Faktoren umfassend mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Die Tablets sollen es den Schüler:innen je nach Schulform und pädagogischem Anlass ermöglichen, jederzeit mit einem eigenen digitalen Endgerät arbeiten und lernen zu können. Zudem wird den Projektschulen Wochenarbeitszeit zur Verfügung gestellt, um für eine technische Vollausstattung schulspezifische didaktische Konzepte zu entwickeln und sich mit den anderen Projektschulen über ihre Erfahrungen auszutauschen.
Auftakt des Projekts
Den Auftakt dazu bildete das 1. Netzwerktreffen an der Lessing-Stadtteilschule in Harburg am 26.09.23. Es wurde von der Stabsstelle Digitalisierung moderiert und, wie das gesamte Projekt, begleitet. Die Schulen sprachen über ihre individuellen Projektziele, dachten über wichtige Meilensteine nach und visualisierten erstmals ihr Konzept einer voll digitalisierten Schule. Die Richtung dabei geben die drei anzuvisierenden Handlungsfelder vor:
1. Unterricht weiterentwickeln
2. Schule digital organisieren
3. Schule kooperativ gestalten
Schulentwicklung geht am besten gemeinsam
„Wo sind wir bereits Expert:innen?“, war anschließend die Frage des Nachmittags, die sich alle Schulen zu beantworten hatten. Denn jede Schule verfügt im Hinblick auf digitale Schulentwicklung bereits über Ressourcen. Es hilft diese sichtbar zu machen und daran anzuknüpfen. Insbesondere dann, wenn es darum geht die eigenen Kolleg:innen auf diese Reise mitzunehmen. Doch nicht nur für die eigene Schule, sondern auch für eine konstruktive und wechselseitige Netzwerkarbeit ist das Wissen über eigene Ressourcen ausschlaggebend. Denn nachhaltige und umfassende Schulentwicklung funktioniert nur, wenn man, anstatt „Topfgucker“ zu fürchten, seine eigenen Erfolge mit denen anderer Schulen teilt und so gemeinsam wächst und voneinander lernt.
Die Lessing-Stadtteilschule…
…stellte als Gastgeberin dieses Treffens ihre schuleigene Infrastruktur vor. So nutzt die Schule beispielsweise ihre Bibliothek als Logistikzentrale. Derzeit werden 1500 iPads in der Schule und im Home-Office genutzt. Treten Probleme mit den technischen Endgeräten auf, können Kolleg:innen und Schüler:innen diese über das Störungmodul von IServ gezielt melden und anschließend den Bearbeitungsstatus ihres Problems stets im Blick behalten. Um diese Masse an Geräten angemessen verwalten und didaktisch sinnvoll nutzen zu können, hat die Schule ein großes multiprofessionelles Team zusammengestellt. Dieses besteht unter anderem aus 10 Jahrgangsmultiplikator:innen, je ein:e Vertreter:in jedes Jahrgangs, um ein ganzheitliches und jahrgangsübergreifendes Arbeiten hinsichtlich der Umsetzung des schulischen Medicurriculums zu ermöglichen. Hinzukommen mehrere schulintern besetzte Funktionen (z.B. für die Aufgabe „Digitalität im Unterricht“) und Verwaltungsangestellte, die sich um IT, Bibliothek und andere damit verbundene Aufgaben kümmern. Mit den sogenannten „Schüler:innen-Multis“ werden zudem einzelne Schüler:innen zu Expert:innen ausgebildet, die ihren jeweiligen Jahrgang unterstützen indem sie Workshops organisieren, DigiSnacks erstellen, Ausschau nach neuen digitalen Trends halten oder schlicht bei technischen Fragen unterstützen.
Bereichert und erfüllt von zahlreichen Eindrücken kehrten die Teilnehmer:innen an ihre Schulen zurück. Der Auftakt des Projektes macht allen Lust auf mehr!